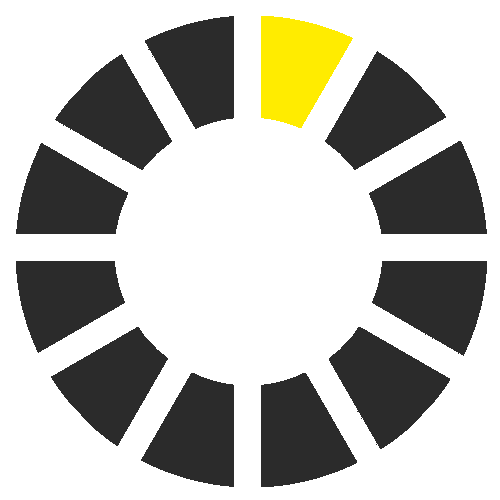Nachhaltig reinigen
Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselthema in der Reinigungsbranche. Aussagen darüber müssen allerdings verlässlich und vergleichbar sein. Im Zentrum steht die Kreislaufwirtschaft, um Ressourcen zu schonen. Bei Reinigungsgeräten zählen vor allem Langlebigkeit, Materialeffizienz und Recyclingfähigkeit. Kunststoffrezyklate reduzieren den Einsatz von primären Kunststoffen und ein geringerer Energie- und Wasserverbrauch senkt die Emissionen der Geräte. Bei der Reinigungschemie ist Effizienz im Einklang mit Umweltschutz gefragt. Nicht zu vergessen sind ergonomische Produkte, die den Anwender in den Fokus nehmen.

Kreislaufwirtschaft für Geräte
Über den Lebenszyklus eines Produktes möglichst wenig Ressourcen verlieren, möglichst viel wiederverwerten und möglichst wenig Schaden anrichten: Das ist der Kern der Kreislaufwirtschaft. Die Strategie erstreckt sich von der Lieferkette über Produktion und Logistik bis hin zur Nutzungsphase und dem Ende eines Produkts, der Wiederverwertung.


Das Material: Reduzieren und wieder verwenden
Um Material einzusparen, muss bereits die Konstruktion darauf hinarbeiten, mit so wenig Material wie möglich ein qualitativ hochwertiges Produkt zu realisieren. Hinzu kommt der Einsatz von Rezyklat, wobei darauf zu achten ist, dass beispielsweise wiederverwertete Kunststoffe alle Anforderungen an Stabilität und Robustheit in der Anwendung erfüllen. Eine andere Möglichkeit ist der Einsatz von natürlichen Inhaltsstoffen, die aus Abfällen der Lebensmittel- oder Agrarindustrie stammen sollten, um keine Nahrungsmittel zu verschwenden. Bei der Konzeption des Produkts ist zudem wichtig, dass es sich einfach warten und reparieren lässt, weshalb die Verfügbarkeit von Ersatzteilen eine zentrale Rolle spielt. Zudem sollte die Reparatur durch Standardwerkzeug und wenige Demontageschritte leicht zu bewerkstelligen sein.
Unterschied Rezyklat und Regranulat
Letztlich ist jedes nicht produzierte Neuprodukt ein Beitrag zur Ressourcenschonung. Damit rücken Konzepte in den Vordergrund, die über die Rückführung, Weiterverwendung oder das Sharing, also die gemeinsame Nutzung von Produkten gehen und somit den Bedarf einer Neuanschaffung reduzieren. In diese Richtung arbeiten auch Hersteller, die ihre Produkte auf Langlebigkeit hin entwickeln – denn je länger die Nutzungsphase eines Geräts ist, desto später besteht Bedarf für ein neues Produkt.
Tipp – wichtige Unterscheidung:
Rezyklat ist Kunstoff, der Müll war und professionell aufbereitet wurde. Regranulat ist Kunststoff, der in der Produktion als Ausschuss angefallen ist und direkt wieder verwendet wird. Diese Unterscheidung ist wichtig, um Zahlen beispielsweise zum Rezyklatanteil korrekt anzugeben.

Ressourceneinsatz und Emissionen: Reduzieren, Reduzieren, Reduzieren
Ob Methan oder CO2 – die Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase steht im Mittelpunkt vieler Lösungen, die auf Nachhaltigkeit abzielen. Unternehmen, die in der Produktion auf erneuerbare Energien und in der Logistik auf platzsparende, rezyklierbare Verpackungen oder sogar auf den Verzicht von Verpackungen setzen, tragen maßgeblich zum Klimaschutz bei. Über das Local-for-Local-Konzept, das auf regionale Beschaffungs-, Produktions- und Transportstrukturen ausgelegt ist, werden weite Transportwege und damit verbundene Emissionen vermieden.
Wie groß der Anteil der Emissionen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg in den verschiedenen Phasen ist, hängt von der Produktart ab. So hat ein Reinigungsgerät, das Strom, Wasser und Chemie verwendet, den Großteil seiner Emissionen in der Nutzungsphase und an zweiter Stelle im Materialeinsatz. Bei Reinigungsmitteln oder -tools hingegen liegt der Fokus bei den Emissionen vorrangig im Bereich Material und danach im Transport.
Für Anwender vergleichbar sind Verbrauchswerte von Geräten, wobei ein geringer Verbrauch von Ressourcen wie Strom, Wasser und Reinigungschemie im Vordergrund steht. Je energieeffizienter und ressourcenschonender ein Produkt, desto besser für die CO2-Bilanz des Anwenders. Einen weiteren Einfluss auf die CO2-Bilanz des Produktes hat der verwendete Strommix. Kommt 100 Prozent Grünstrom zum Einsatz, reduziert sich der CO2-Fußabdruck in der Nutzungsphase fast auf Null, abhängig davon, ob weitere Einflussfaktoren wie Wasser oder Chemie zum Tragen kommen oder nicht.


Ökomodus senkt Verbrauch
Im Sinne eines Nachhaltigkeitsbegriffs, der auch den Anwender bzw. das direkte Umfeld in den Blick nimmt, spielen Staub- und Lärmemissionen eine zentrale Rolle. Kehrmaschinen oder Staubsauger, die über leistungsstarke Lösungen zur Filtration verfügen, entfernen Staub, Feinstaub und je nach Filterklasse sogar gesundheitsschädliche Partikel aus der Abluft. Im Bereich der Geräuschemissionen sind akkubetriebene Geräte ein wichtiger Bestandteil im Portfolio – egal, ob es sich um Laubbläser für das Arbeiten in Außenanlagen oder besonders leise Trockensauger für die Reinigung in Innenräumen handelt.
Der Abfall: Am besten auf Null setzen
Auch wenn Produkte sich gut warten lassen, auf Langlebigkeit ausgelegt sind und gegebenenfalls in einem Wiederverwendungs-Pool (Reuse) nach der ersten Nutzungsphase weiter benutzt wurden, kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem das Ende des Lebenszyklus erreicht ist. Nun zeigt sich, wie rezyklierbar die Bauteile des Geräts sind. Verfolgte der Hersteller die Design-for-Recycling-Strategie, so sollte der Kunststoff gut wiederverwertbar sein. Dazu gehört beispielsweise, dass Bauteile nicht geklebt, sondern gesteckt werden und somit leicht demontierbar sind. Auch eine Lackierung lässt sich einsparen, um die Wiederverwertung zu ermöglichen, so dass am Ende möglichst wenig nicht verwertbarer Abfall übrig bleibt. Themen wie die Vermeidung von potenziell gefährlichen Stoffen, die gesondert abzuführen sind, sowie die Reduktion von Mikroplastik sollten inzwischen bei allen Herstellern zum Standard gehören.
Tipp – Verbrauch reduzieren:
Viele Geräte bieten einen Ökomodus, der den Verbrauch reduziert und trotzdem ein sehr gutes Reinigungsergebnis bringt, wenn es sich nicht um hartnäckige Verschmutzungen handelt.
Nachhaltige Reinigungschemie
Reinigungschemie ist in vielen Fällen unerlässlich, um Verschmutzungen wirksam zu beseitigen – das gilt für Anwendungen in der Industrie ebenso wie für Anwendungen in Gastgewerbe, Landwirtschaft oder in der Gebäudereinigung. Doch wie geht Reinigungschemie nachhaltig?
Das Geheimnis der Wirkstoffe: Von kombinatorischer Chemie bis zu nachwachsenden Rohstoffen
Ein wesentlicher Punkt zur Einschätzung der Bedeutung von Reinigungsmitteln ist der Sinner’sche Kreis: Es werden Zeit, Mechanik, Temperatur und Chemie benötigt, um ein gewünschtes Reinigungsergebnis zu erzielen. Wird die Wirkung einer Komponente reduziert, beispielsweise die Chemie, müssen die anderen Komponenten das ausgleichen. Mikrofasertücher können zum Beispiel den Einsatz von Reinigungsmitteln in der Oberflächenreinigung reduzieren, da sie leicht abrasiv sind – werden allerdings gar keine Reinigungsmittel verwendet, muss die Reinigungskraft sehr viel Kraft, also Mechanik, aufwenden, um die Bildung einer Schmutzschicht zu verhindern. Dieses Beispiel zeigt, dass immer zu entscheiden ist, ob bzw. wie im Bereich der Reinigungschemie nachhaltig agiert werden kann. Hinzu kommt, dass es Verschmutzungen wie Fett, Öl oder Vogelkot gibt, die sehr hartnäckig sind, so dass Reinigen ohne Reinigungsmittel schwierig ist.
Um umweltfreundliche Reinigungsmittel zu entwickeln, vermeiden viele Hersteller Zusammensetzungen auf Erdöl-Basis und arbeiten stattdessen mit nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist zu beachten, dass zum einen keine Regenwaldflächen abgeholzt werden dürfen, um Anbauflächen zu gewinnen. Zum anderen sollte es sich auch nicht um eine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion handeln. Idealerweise kommen Abfallprodukte aus der Nahrungsmittelfertigung aus lokalen Quellen zum Einsatz, da auf diese Weise keine Ressourcen verschwendet werden und auch keine neuen Logistikketten rund um den Globus entstehen.
Alternativ lassen sich durch die Anwendung der sogenannten kombinatorischen Chemie Reinigungsmittel mit sehr gutem Wirkungsgrad entwickeln, die dennoch kennzeichnungsfrei sind und Umwelt und Anwender so wenig wie möglich belasten. In der Produktentwicklung werden dazu Synergien zwischen verschiedenen Rohstoffen untersucht und die beste, möglichst umweltschonende Kombination ermittelt, um eine sehr gute Reinigungsleistung zu erzielen.
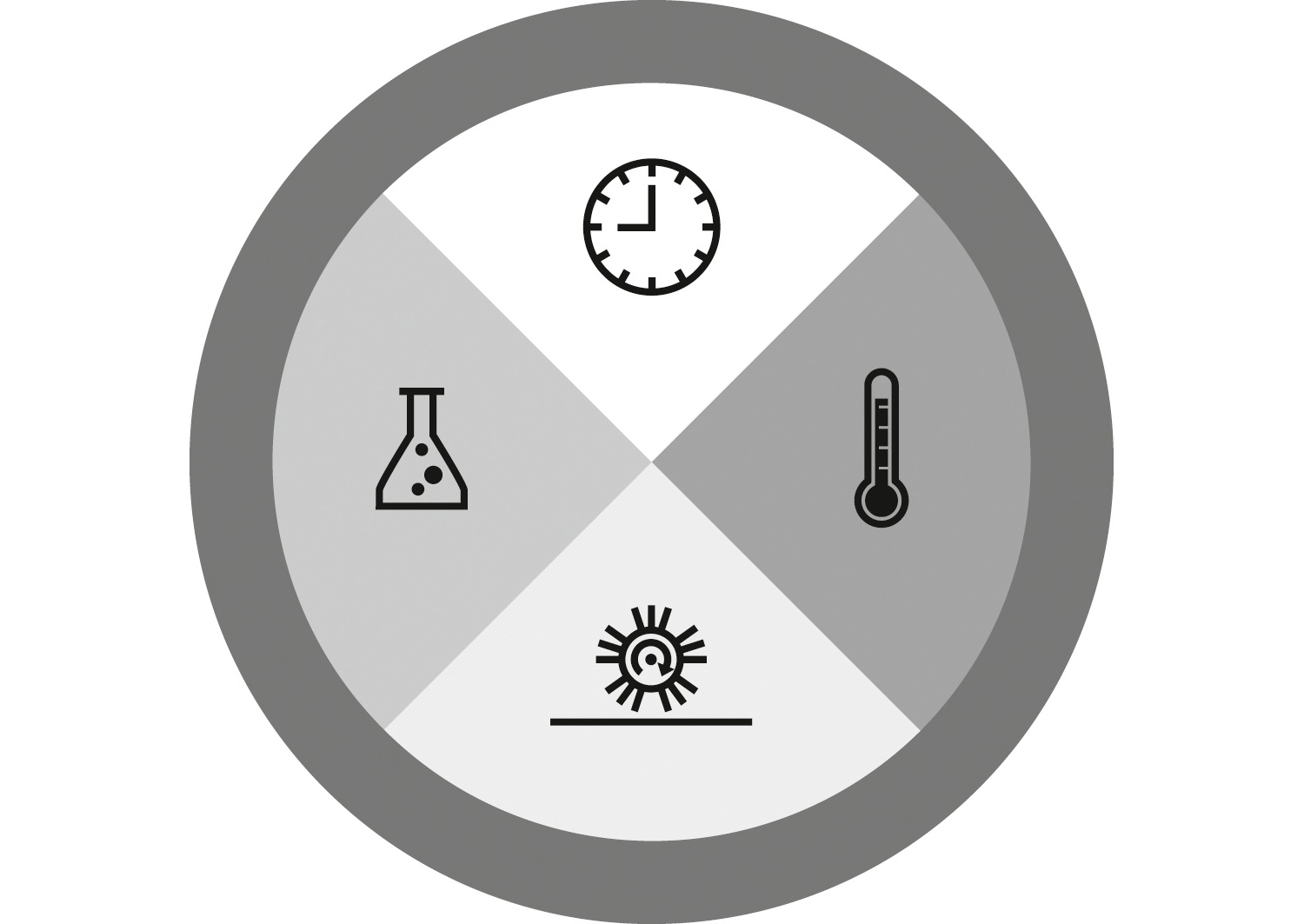

Auf die Dosierung kommt es an: Von Hochkonzentraten und cleveren Dosierkonzepten
Jenseits der verwendeten Rohstoffe sind in puncto Nachhaltigkeit von Reinigungsmitteln und ihrem CO2-Footprint weitere Aspekte zu berücksichtigen. Ultrahochkonzentrate zum Beispiel bieten den Vorteil, dass sehr wenig davon sehr viel Wirkung erzielt. Damit ergibt sich eine große Ersparnis in Verpackungsmaterial, Logistik und Transport, da viel kompaktere Gebinde in geringerer Anzahl in Umlauf kommen.
Produktion und Logistik bei Reinigungsmitteln beachten
Ein weiterer Aspekt, der nicht vergessen werden sollte, liegt in der korrekten Dosierung der Reinigungsmittel. Dazu tragen Dosierstationen ebenso bei wie anwenderfreundliche Sprühflaschen und natürlich Reinigungstechnik, über die sich die Dosierung an den Verschmutzungsgrad anpassen lässt oder die einen Verzicht auf Reinigungschemie erlaubt.
Tipp 1 – Produktion und Logistik bei Reinigungsmitteln beachten:
Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln auf Basis nachwachsender Rohstoffe sollten auch Produktion und Logistik betrachtet werden, um sich für eine insgesamt nachhaltige Lösung zu entscheiden.
Tipp 2 – Höhere Einwirkzeit bei Reinigungsmitteln in Schaumform:
Reinigungsmittel in Schaumform erhöhen die Einwirkzeit, so dass bei geringerer Dosierung eine vergleichbare Wirkung erzielt wird.
Effizienz und Ergonomie für nachhaltiges Arbeiten
Nachhaltigkeit im Sinne der Ressourcenschonung dreht sich oft um Materialien, Wirkstoffe und Emissionen, mindestens ebenso wichtig sind aber ein kluges Reinigungskonzept und ergonomische Arbeitsabläufe. Denn so wird nur dort gereinigt, wo es wirklich notwendig ist – und Mitarbeitende werden körperlich nicht zu sehr belastet.

Reinigungskonzept spart Reinigungsaufwand: Regelmäßigkeit bietet hohen Mehrwert
Stringente Reinigungskonzepte bilden ebenfalls eine wichtige Grundlage, um in der Reinigung bei gleichbleibend hoher Qualität den Aufwand zu reduzieren und die Lebensdauer von Objekten oder Bodenbelägen zu verlängern. Das Konzept PDIR besteht aus vier aufeinander aufbauenden Bausteinen:
- “P” für “Preventative” zielt darauf ab, dass Schmutz und Staub gar nicht erst in ein Gebäude gelangen. Vorbeugende Reinigungsmaßnahmen im Außenbereich sowie Sauberlaufzonen im Eingangsbereich reduzieren den Schmutzeintrag und damit den Reinigungsbedarf im Innenraum.
- “D” für “Daily” betont den Stellenwert der täglichen Unterhaltsreinigung. Werden Verunreinigungen möglichst zeitnah mit den passenden Methoden entfernt, geht es meistens schneller und ohne großen Aufwand vonstatten.
- “I” für “Interim” rückt die Bedeutung von ressourcenschonenden Zwischenreinigungsverfahren in den Fokus. Damit lassen sich Oberflächen und Böden wieder in einen optisch guten, ordentlichen Zustand bringen, was die Intervalle zur nächsten Grundreinigung verlängert.
- “R” für “Restorative” hebt darauf ab, dass Grundreinigungsverfahren einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die Lebensdauer von Materialien zu erhöhen. Auch der Bedarf für Reparaturen oder komplette Erneuerungen wird verringert, was über die Zeit hohe Kostenersparnisse mit sich bringt.

Ergonomie schont den Anwender: Worauf zu achten ist
Kein Produkt ist am Ende nachhaltig, das nicht auch den Anwender in den Fokus nimmt. Alles, was das Arbeiten erleichtert oder körperliche Belastungen reduziert, ist in diesem Sinne zu berücksichtigen. Dabei ist das Thema sehr breit gefächert, denn Ergonomie steckt in Geräten ebenso wie in Methoden oder neuen Technologien.
Das können Reinigungswagen sein, die ein Plattformkonzept verfolgen, so dass sich einzelne Bestandteile passend zur jeweiligen Reinigungsaufgabe abkoppeln lassen. Auch Methoden wie die Vorkonditioniert- oder Sprühmethode erleichtern die Arbeit, da kein schwerer Eimer mit zehn bis fünfzehn Liter Wasser mehr gehandhabt werden muss. Stattdessen sind Mikrofasertücher oder -mopps mit der passenden Menge Wasser und Reinigungsmittel getränkt und lassen sich sofort verwenden. Akkubetriebene Geräte wiederum punkten dadurch, dass kabelloses Arbeiten einfacher ist, Unfallgefahren vermeidet und viele Wege einspart.
Tipp – Anpassbare, wendige Reinigungsmaschinen:
Maschinen sollten sich an Anwender mit unterschiedlicher Körpergröße anpassen lassen, Sitze einstellbar sein und genügend Beinfreiheit bieten. Zudem sollten handgeführte Maschinen wendig sein und idealerweise über einen Fahrantrieb verfügen.
Passende Produkte für Ihren Anwendungsbereich
Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Professional Product Finder
Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.