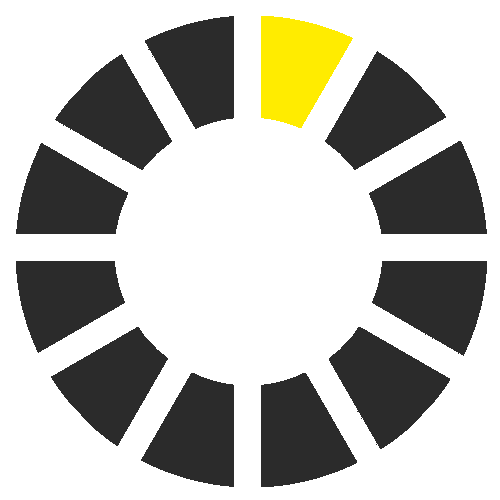Winterdienst
Klimawandel und Verkehrswende stellen den Winterdienst vor immense Herausforderungen: Umweltauswirkungen wie beispielsweise verringerter Schneefall, plötzliche Wintereinbrüche oder Blitzeis. Gleichzeitig werden Fahrradwege massiv ausgebaut, denn immer mehr Verkehrsteilnehmer steigen der Umwelt zuliebe oder wegen höherer Energiekosten auf das Fahrrad um. Welche Methoden gibt es für Kommunen, Bauhöfe, externe Dienstleister und Gebäudereiniger, um weiterhin ökologisch, ökonomisch und ergonomisch zu arbeiten? Welche Geräteträger und Anbaugeräte werden wofür eingesetzt?

Gewappnet für den Winter
Auch der Winterdienst spürt die Folgen des Klimawandels und muss sich der Verkehrswende anpassen. Um den geänderten Aufgaben gerecht zu werden, ist es wichtig, die Einsatzplanung flexibel zu gestalten.

Wenn das Winterwetter verrücktspielt: bedarfsgerechte Räumung
Der Klimawandel sorgt dafür, dass Winterdienst neu gedacht werden muss: weg von starren Einsatzplänen, hin zu mehr Flexibilität, um auf plötzliche Wintereinbrüche zu reagieren. Wer unter den gegebenen Voraussetzungen weiterhin ökonomisch arbeiten möchte, braucht eine kluge Planung und Organisation der Einsatzgruppen. Eine bedarfsgerechte Räumung ist dafür die wirksamste Strategie, wobei moderne Technologien helfen können.
Radwegeräumung: kein Risiko eingehen
Doch nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Verkehrswende sorgen für neue Herausforderungen. Immer mehr Verkehrsteilnehmer steigen der Umwelt zuliebe oder aus Kostengründen auf das Fahrrad um. Diese Trendwende lässt das Fahrradnetz beispielsweise in Deutschland immer weiter wachsen. So betrug die Gesamtstrecke im Jahr 2020 knapp 7000 Kilometer. Heute sind es bereits rund 12.000 Kilometer. Aktuell besteht laut gesetzlichen Vorgaben auf Radwegen noch keine Räumpflicht. Allerdings ist Räumen und Streuen für Kommunen und Bauhöfe trotzdem sinnvoll, um Unfälle zu vermeiden.
Tipp 1 – einen Schritt voraus Temperatursensoren:
Temperatursensoren im Asphalt können dabei helfen, anstehenden Schneefall oder plötzliche Glätte vorab zu erkennen und die Einsatzplanung am tatsächlichen Bedarf entlang vorzunehmen.
Tipp 2 – Priorisierung bei Blitzeis:
Bei Blitzeis oder Reifglätte sollten sensible Punkte wie Senken oder Brückenunterführungen priorisiert behandelt werden, um Unfallschwerpunkte zu entschärfen.
Auswahl der Geräte und Ausstattung
Um effizient und ökonomisch zu arbeiten, sollten Streugeräte und Streumittel passend zum Einsatz gewählt werden. Schmalspurfahrzeug, Knicklenkung, Anbau- oder Anhängewalzenstreuer, auftauende oder abstumpfende Streumittel – ein Überblick.

Der passende Geräteträger: Schmalspurfahrzeug oder Knicklenkung
Für Geräteträger gilt generell: Eine gute Sicht in der Kabine und passende Beleuchtung sind für die Verkehrssicherheit zentral. LED-Licht ist im Winter bedingt geeignet, da es stark reflektiert. Zudem sollte die Kabine gut klimatisiert sein, damit die Scheiben nicht beschlagen. Ein beheizter Fußraum schafft auch bei längeren Touren ein angenehmes Arbeitsumfeld für den Anwender. Ergonomisch konzipierte Geräteträger sorgen nicht nur für Verkehrssicherheit, sondern erleichtern auch die Arbeit. Für den Winterdienst in Innenstädten mit umfangreichem Geh- und Radwegenetz sind Schmalspurfahrzeuge besonders gut geeignet. Da diese sowohl schmal als auch weit streuen, können sie sowohl für schmale Geh- oder Radwege als auch für große Markt- oder Parkplätze zum Einsatz kommen. Geräteträger mit Knicklenkung sind wendig und lassen sich leicht manövrieren, denn das Anbaugerät folgt dem Zugfahrzeug spurtreu. Trägerfahrzeug und Anbaugeräte müssen aufeinander abgestimmt sein. Grundsätzlich gilt: Geräteträger für den Winterdienst sollten mit permanentem Allradantrieb ausgestattet sein. Passend zum Einsatz ist das geeignete Anbaugerät zu wählen.
Anbau- und Anhängewalzenstreuer & Co.: Worauf es bei Anbaugeräten ankommt
Was das Streugerät betrifft, gibt es ebenfalls allgemeine Aspekte zu berücksichtigen. So sollten nur korrosionsbeständige Maschinen mit Komponenten aus Kunststoff oder Stahlkonstruktionen mit geeigneter Lackierung und Korrosionsschutz gewählt werden. Aus ökonomischen und ökologischen Gründen sind eine gleichmäßige Streudichte und eine an Witterung und Glätte angepasste, variable Dosierqualität ebenfalls sehr wichtig. Damit bei längeren Touren und maximaler Streudichte kein Nachladen erforderlich wird, muss das Gerät über eine ausreichende Ladekapazität verfügen.
Anbau- und Anhängewalzenstreuer sind kompakt und somit für schmale Geh- oder Radwege geeignet. Problematische Streustoffe werden sicher ausgebracht und nicht ausgeschleudert. Zusätzlich bieten sie eine Nachlademöglichkeit von der Ladefläche des Fahrzeugs aus. Dank der fixierten Streubreite sind auch längere Einsätze möglich. Streuer mit Streuteller sind dank ihrer variablen Streubreite von circa 70 Zentimetern bis zu 6 Metern auf schmalen Gehwegen oder großen Plätzen flexibel einsetzbar. Aufsattelstreuer sind kompakt gebaut und bieten ein großes Behältervolumen, hohen Bedienkomfort und Dosiergenauigkeit. Zu beachten sind allerdings die längeren Rüstzeiten und die hohen Anschaffungskosten.
Auftauende oder abstumpfende Streumittel: je nach Ziel die richtige Wahl
Passend zu Umgebung und Witterungsverhältnissen, gilt es, den richtigen Streustoff zu wählen. Es gibt auftauende Stoffe mit flächenhaftender Wirkung, die Eis zu Wasser schmelzen. Restsalz verbleibt dann im trockenen Zustand auf dem Untergrund und verhindert erneutes Anfrieren. Daneben gibt es abstumpfende Streustoffe (z. B. kubischer Splitt, Brechsand oder Granulat). Diese werden in die Schneedecke gedrückt und erhöhen den Reibungswiderstand, bieten allerdings keine dauerhafte Wirkung. Eine weitere Variante sind Feuchtsalzstreuer, die zusätzlich zum Trockenstoffbehälter mit Soletanks ausgestattet sind. Trockensalz und Sole werden auf einem Streuteller vermischt und die von Sole umschlossenen Salzkörner anschließend auch bei unterschiedlichen Streubreiten, Streudichten und Fahrgeschwindigkeiten gleichmäßig ausgebracht. Je nach gewähltem Streugut, ist die passende Kombination aus Geräteträger und Anbaugerät einzusetzen.
Tipp 1 – Präventives Streuen mit Sole:
In Großkommunen entwickelt sich der Trend Richtung Präventives Streuen mit Sole: Am Tag vor angekündigter Reifglätte oder voraussichtlichem Schneefall kann der Untergrund mit Sole angetaut werden. Das erleichtert am Folgetag das Räumen, sodass auch kleinere Mannschaften ausreichen.
Tipp 2 – Schneeketten verwenden:
Bei extremen Verhältnissen sind am Trägerfahrzeug Schneeketten nötig, um die Traktion vom Fahrzeug auf die Straße zu erhöhen.
Die Methoden des Schneeräumens
Wenn Schnee geräumt werden muss, stehen dem Winterdienst unterschiedliche Methoden und Maschinen zur Verfügung, je nach Zielsetzung, Schneemenge und Umgebung.
Weiß- oder Schwarzräumung: Welche Methode wofür?
In puncto Schneeräumen gibt es 2 mögliche Methoden: Bei der sogenannten Weißräumung wird der Neuschnee zur Seite geschoben und der verbleibende Schnee festgefahren. Anschließend wird auf die feste Decke Streugut, zum Beispiel Splitt, aufgebracht. Dieses Verfahren kommt zum Beispiel bei Wanderwegen in touristischen Gebieten zum Einsatz. Bei der Schwarzräumung dagegen wird die Fahrbahn bis zum Teer komplett von Schnee und Eis befreit. Dieses Verfahren wird beispielsweise bei Autobahnen oder Radwegen angewendet.

Schwarzräumung bei wenig Schnee: Frontkehrmaschine mit Schneekehrwalzen
Ist eine schwarzgeräumte Straße gewünscht, bietet eine Frontkehrmaschine mit Schneekehrwalzen entscheidende Vorteile: Die elastischen Räumelemente passen sich an unebenen Straßenuntergrund an und erzielen dadurch sehr gute Ergebnisse. Außerdem werden circa 40 Prozent Streugut eingespart, was die am Straßenrand wachsenden Pflanzen schützt. Allerdings benötigt die Maschine mehr Zeit als ein Pflug. Außerdem ist ein frühzeitiger Einsatz nötig, da verdichteter Schnee nicht gelöst werden kann und auch die Schneehöhe, bei der gearbeitet werden kann, begrenzt ist.

Größere Schneemengen und fester Schnee: Der Pflug schafft’s
Ein Schneepflug schiebt auch große Schneehöhen schnell und effizient von der Straße. Selbst fester Schnee löst sich bei einer hohen Räumgeschwindigkeit. Beim Räumen mit dem Pflug ist von Nachteil, dass der auf die Seite geschobene Schnee stark verdichtet wird und somit langsamer taut.
Tipp 1:
Eine zu harte Schürfleiste des Pflugs kann den Untergrund beschädigen.
Tipp 2:
Wenn sehr wenig Schnee liegt, ist Schneekehren mit einer freikehrenden Kehrmaschine völlig ausreichend.
Große Schneemengen beseitigen
Bei starkem Wintereinbruch in höheren Lagen ist eine Schneefräse nötig, wenn die Schildhöhe des Schneepflugs nicht mehr ausreicht. Bei zu langem, starkem Schneefall muss der geräumte Schnee teilweise vom Fahrbahnrand entfernt werden, ohne den Verkehr zu behindern.

Bei starkem Wintereinbruch: Schneefräse gegen Schneemassen
Eine Schneefräse wird auch mit großen Schneemassen fertig. Rotierende Werkzeuge erfassen dabei den Schnee, beschleunigen und werfen ihn gezielt aus. Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt dabei zwischen 0,5 und 4 Kilometer pro Stunde bei einer Wurfweite von bis zu 40 Metern. Die Fräse wird durch den Motor des Fahrzeugs angetrieben. Die Zapfwelle ist dabei das zentrale mechanische Element. Sie wird vom Motor angetrieben und sollte möglichst viel Kraft auf das Anbaugerät übertragen.
Schneebeseitigung mit Lkw: Schnee adé ohne Nachtschicht und Verkehrschaos
Auf viel befahrenen Straßen, vor allem in den Bergen, muss der geräumte Schnee nach heftigen Schneefällen vom Fahrbahnrand entfernt werden. Das ist tagsüber mitten im fließenden Verkehr nur möglich, wenn ein schmaler Geräteträger in Verbindung mit einem Lkw zum Einsatz kommt. Der Geräteträger fährt hinter dem Lkw her und wirft den Schnee auf die Ladefläche. Dabei muss nicht rangiert werden und Autos können vorsichtig überholen. Das Verladen von Schnee mit Radladern ist dagegen nicht empfehlenswert, denn durch das Rangieren wird der Verkehr behindert – somit ist Nachtarbeit nötig.
Tipp 1 – passende Geräteträger:
Am Markt sind verschiedene Geräteträger für Schneefräsen erhältlich. Das Angebot reicht von Modellen ab 26 PS für kleinere Einsätze, beispielsweise an Hotels, Industrie- oder Bürogebäuden im innerstädtischen Bereich, bis zu 130 PS für schwere Wintereinsätze.
Tipp 2 – lastabhängiger Vortrieb:
Für den Fahrer besonders entlastend sind Geräteträger mit lastabhängigem Vorwärtstrieb. Sie passen Fahrgeschwindigkeit an Schneemenge und -beschaffenheit an. Bei festgedrücktem, schwerem Schnee wird die Geschwindigkeit automatisch reduziert und bei leichtem Schnee erhöht, da die Fräse weniger Kraft benötigt.
Winterdienst clever gedacht: So verlieren die Herausforderungen ihren Schrecken
Damit Einsätze möglichst in der Tagschicht erfolgen können und das Personal entlastet wird, ist es wichtig, das passende Fahrzeug zu wählen und ergonomische Gesichtspunkte zu beachten. Mit der geeigneten Gerätschaft, kluger Einsatzplanung und der richtigen Methode erreichen Kommunen, Bauhöfe oder externe Dienstleister ihre Ziele ökonomisch und sorgen gleichzeitig für Verkehrssicherheit und Mitarbeiterzufriedenheit.
Passende Produkte für Ihren Anwendungsbereich
Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Professional Product Finder
Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.